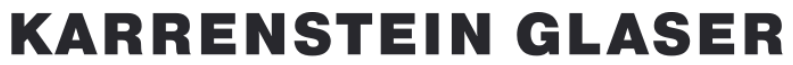Was ist ein Insolvenzplan?
Ein Insolvenzplan ist ein Sanierungs- oder Abwicklungsplan, der im Rahmen eines Insolvenzverfahrens erstellt wird. Sein Ziel ist es, entweder eine Unternehmensfortführung zu ermöglichen oder eine geordnete Abwicklung zu gewährleisten. Der Plan kann abweichend von den allgemeinen Vorschriften der InsO die Befriedigung der Gläubiger, die Verwertung der Insolvenzmasse, deren Verteilung und die Haftung des Schuldners nach dem Insolvenzverfahren regeln, sofern die gesetzlichen Grenzen eingehalten werden (§ 217 Abs. 2 InsO). Das Obstruktionsverbot, das eine Schlechterstellung der Gläubiger verhindern soll, ist zu beachten (§ 245 InsO).
Zweck des Insolvenzplans
Der Insolvenzplan dient mehreren Zwecken:
Unternehmenssanierung:
Er ermöglicht die Sanierung des Unternehmens durch Anpassung der Forderungen und Rechte der Gläubiger.
Gläubigerschutz:
Durch den Plan können Gläubiger ihre Forderungen, wenn auch teilweise, befriedigt sehen, was oft eine bessere Alternative zur Liquidation darstellt.
Schuldnerbefreiung:
Er kann dem Schuldner eine Chance geben, sich von seinen Verbindlichkeiten zu befreien.
Gleichbehandlung:
Innerhalb der jeweiligen Gruppen stellt er sicher, dass die Gläubiger gleichbehandelt werden (§ 226 InsO). Unterschiede zwischen den Gruppen sind jedoch zulässig, solange sie sachlich gerechtfertigt sind. Die unterschiedliche Behandlung muss begründet sein (und werden).
Aufbau des Insolvenzplans
Der Insolvenzplan besteht aus zwei Teilen:
Darstellender Teil (§ 220 InsO):
Hier werden die wirtschaftliche Lage des Schuldners, die Ursachen der Insolvenz und die geplanten Sanierungs- oder Abwicklungsmaßnahmen beschrieben. Dieser Teil soll die Grundlage für die Entscheidung der Gläubiger über den Plan legen.
Gestaltender Teil (§ 221 InsO):
Dieser Teil legt fest, wie die Rechte der Beteiligten geändert werden sollen. Dazu gehören Forderungskürzungen, Stundungen, Zinsanpassungen oder Umwandlungen von Forderungen in Anteile am Unternehmen (Debt-Equity-Swap). Maßnahmen wie ein Debt-Equity-Swap bedürfen jedoch der Zustimmung der betroffenen Gläubiger (§ 225a Abs. 2 InsO).
Zusätzlich müssen bestimmte Anlagen beigefügt werden, wenn die Gläubiger aus den künftigen Erträgen des fortgeführten Unternehmens befriedigt werden sollen. Dazu gehören eine Vermögensübersicht und ein Ertrags- und Finanzplan (§ 229 InsO). Falls erforderlich, können weitere Unterlagen zur Beurteilung des Plans beigelegt werden.
Ablauf des Insolvenzplanverfahrens und Auslegung
- Vorlage des Plans
Der Insolvenzverwalter oder der Schuldner kann einen Insolvenzplan beim Insolvenzgericht vorlegen (§ 218 InsO). Die Gläubigerversammlung kann den Verwalter beauftragen, einen Plan zu erstellen. Häufig wird der Insolvenzplan von den Beratern den Schuldners erstellt.
- Prüfung des Plans
Das Insolvenzgericht prüft den Plan auf formale und inhaltliche Richtigkeit. Es kann den Plan gemäß § 231 Abs. 1 Nr. 2 InsO zurückweisen, wenn offensichtlich keine Aussicht auf Annahme oder Bestätigung besteht. Andernfalls wird der Plan zur weiteren Behandlung zugelassen. Wurde bereits ein vom Schuldner vorgelegter Plan von den Beteiligten abgelehnt, vom Gericht nicht bestätigt oder vom Schuldner zurückgezogen, hat das Gericht einen neuen Plan des Schuldners zurückzuweisen, wenn Insolvenzverwalter die Zurückweisung beantragt.
- Erörterung und Abstimmung
In einem Erörterungstermin werden die Bestimmungen des Plans diskutiert. Danach findet eine Abstimmung statt, bei der eine Mehrheit der abstimmenden Gläubiger jeder Gruppe und in jeder Gruppe eine Summenmehrheit der Forderungen erforderlich ist, um den Plan anzunehmen (§ 244 InsO).
- Bestätigung des Plans
Nach der Zustimmung der Gläubiger muss das Insolvenzgericht den Plan bestätigen (§ 248 InsO). Das Gericht prüft dabei insbesondere, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und die Interessen der Beteiligten gewahrt sind (§ 251 InsO). Die Bestätigung macht die im Plan festgelegten Regelungen rechtsverbindlich für alle Beteiligten (§ 254 InsO).
- Umsetzung und Überwachung
Nach der Bestätigung wird der Plan umgesetzt. Der Insolvenzverwalter überwacht die Einhaltung des Plans, insbesondere wenn Überwachungsmaßnahmen im Plan vorgesehen sind (§§ 260 bis 269 InsO).
- Beendigung des Verfahrens
Wenn der Plan erfolgreich umgesetzt wird, kann das Insolvenzverfahren aufgehoben und die Überwachung eingestellt werden. Alternativ kann es zu einer erneuten Insolvenz kommen, wenn der Plan nicht eingehalten wird.
Beispiel
Die Situation: Eine kleine Druckerei steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Die Aufträge gehen zurück und die Schuldenlast wächst. Außergerichtliche Versuche einer Einigung mit den Gläubigern sind gescheitert. Die Druckerei ist nun insolvenzantragspflichtig und stellt einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit.
Der Plan: Um das Unternehmen zu retten, wird ein Insolvenzplan erstellt.
Dieser sieht vor:
- Kosten senken: Es werden Ausgaben reduziert und unnötige Verträge beendet, z.B. für Miete und nicht benötigte Software und den Verkauf finanzierter überflüssiger Maschinen.
- Neue Kunden suchen: Der Fokus liegt auf neuen Kunden und Aufträgen, die besonders profitabel sind.
- Schuldenschnitt: Ein Teil der Verbindlichkeiten wird erlassen und weitere werden gestundet und ratierlich getilgt, nachdem die Ertragskraft wieder gegeben ist.
Wie geht es weiter? Der Plan wird dem Gericht vorgelegt und gegebenfalls den Gläubigern vorgestellt. Stimmen diese zu muss das Gericht den Plan noch bestätigen. Dann kann der Insolvenzplan umgesetzt und überwacht werden.
Warum kann das funktionieren? Indem die Druckerei ihre Kosten senkt, neue Kunden gewinnt und einen Teil ihrer Schulden in die Zukunft verschiebt, gewinnt sie wieder Luft zum Atmen. Mit der Zeit kann sie dann ihre verbleibenden Verbindlichkeiten vollständig tilgen und wieder profitabel arbeiten.
Fazit
Der Insolvenzplan ist ein mächtiges Instrument zur Restrukturierung und Sanierung insolventer Unternehmen. Er bietet – innerhalb der gesetzlichen Grenzen – Flexibilität und ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Insolvenzsituationen. Der Erfolg eines Insolvenzplans hängt von seiner sorgfältigen Ausarbeitung, der Zustimmung der Gläubiger und seiner nachhaltigen Umsetzung ab. Durch diesen Mechanismus kann eine wirtschaftliche Fortführung oder eine geordnete Abwicklung erreicht werden, was im Interesse aller Beteiligten liegt.