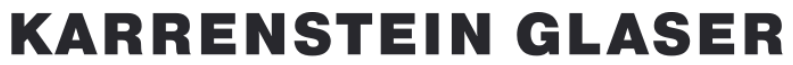Die Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen sind komplexe Prozesse, die sowohl vor als auch im Rahmen eines Insolvenzverfahrens durchgeführt werden können. Sie zielen darauf ab, eine wirtschaftliche Krise zu überwinden und das Unternehmen wieder auf eine nachhaltige Erfolgsbasis zu stellen. Sanierung und Restrukturierung sind sinnvoll, wenn die Wettbewerbsfähigkeit in einem intakten Marktumfeld wiederhergestellt werden kann.
Der Fokus liegt hier auf den juristischen Fragen der Sanierung und Restrukturierung. Dabei spielen verschiedene Instrumente und Verfahren eine zentrale Rolle, insbesondere das „vorinsolvenzliche“ Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) und im Falle eines Insolvenzverfahrens die sogenannte Eigenverwaltung, das Schutzschirmverfahren, der Insolvenzplan und die übertragende Sanierung.
Sanierung und Restrukturierung vor dem Insolvenzverfahren
Vorinsolvenzliche Sanierung bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich frühzeitig umzustrukturieren und eine Insolvenz zu vermeiden. Hier sind einige Instrumente und Verfahren:
Verhandlungsführung:
In der Unternehmenskrise sind im Rahmen der Privatautonomie jederzeit Verhandlungen und Vereinbarungen mit Gläubigern möglich, solange kein zwingender Insolvenzgrund (Insolvenzgründe) gegeben ist. Oft genügt es, wenn den Gläubigern die Situation ausführlich dargelegt wird. Mit der Perspektive eines u.U. erforderlich werdenden Insolvenzverfahrens konfrontiert, können für alle Beteiligten sinnvolle Ergebnisse erzielt werden. Eine außerhalb gesetzlicher Verfahren erfolgende Einigung bietet sich gerade bei kleinen Unternehmen und kleinen mittelständischen Unternehmen mit wenigen Gläubigern an und kann sich als kostenschonend im Vergleich zu gesetzlich normierten Verfahren erweisen. Es besteht jedoch die Gefahr im Falle des Scheiterns, dass die Kooperationsbereitschaft wichtiger Gläubiger in sich anschließenden Verfahren, herabgesetzt ist.
StaRUG:
Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ermöglicht es Unternehmen, sich außerhalb eines Insolvenzverfahrens zu sanieren.
- Sanierungsmoderation: Hierbei handelt es sich um eine frühe außergerichtliche Lösung, bei der ein Moderator zwischen Unternehmen und Gläubigern vermittelt, um eine einvernehmliche Sanierung zu erreichen. Das Gericht kann einen Sanierungsmoderator bestellen.
- Es kann ein Restrukturierungsplan erstellt und ohne gerichtliche Beteiligung abgesegnet werden, sofern bestimmte Mehrheiten erreicht werden. Der Plan kann Maßnahmen zur Schuldenerleichterung, zur Verlängerung von Zahlungsfristen oder zur Umstrukturierung von Verbindlichkeiten beinhalten. Der Restrukturierungsplan muss die Insolvenzvermeidung und die Bestandsfähigkeit konkret darstellen. Die Abstimmung über den Plan kann außergerichtlich unter der Leitung des Unternehmens oder mit Beteiligung des Restrukturierungsgerichts stattfinden. Das Gericht kann die fehlende Zustimmung unter bestimmten Voraussetzungen durch Beschluss ersetzen. Der gerichtlich bestätigte Restrukturierungsplan bindet auch ablehnende, nicht jedoch unbekannte Gläubiger.
- In vielen Fällen werden Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens erforderlich. Das bedeutet, dass die Restrukturierung durch einen Restrukturierungsplan durch gerichtliche Maßnahmen unterstützt oder flankiert wird. Das gilt vor allem, wenn der Plan nicht vorbehaltlos unterstützt wird. Wesentliche Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens sind:
- Gerichtliche Planabstimmung: Ermöglicht das Abhalten einer Versammlung der Planbetroffenen unter Vorsitz des Gerichts.
- Gerichtliche Vorprüfung: Soll Rechtssicherheit bezüglich kontroverser Fragen, die für die Planbestätigung relevant sind, bieten
- Stabilisierungsanordnung: Einschränkung von Rechtsverfolgung durch vollstreckende Gläubiger oder Sicherungsgläubiger.
- Gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans: Soll gewährleisten, dass der Plan auch gegenüber ablehnenden Gläubigern und anderen Betroffenen wirksam wird.
Sanierung und Restrukturierung im Insolvenzverfahren
Auch im Rahmen eines Insolvenzverfahrens gibt es mehrere Wege, die Sanierung und Restrukturierung des Unternehmens voranzutreiben; d.h., dass der Insolvenzantrag nicht zwingend die Liquidation des Unternehmens zur Folge hat.
Eigenverwaltung (§ 270a InsO):
In einer Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung handlungsfähig und führt das Unternehmen unter Aufsicht eines gerichtlich bestellten Sachwalters fort. Ziel ist es – auch wenn dies nicht vorgeschrieben ist – die Sanierung zu erreichen. Der Insolvenzplan (§ 284 InsO) ist ein häufig gewähltes Instrument. Die Eigenverwaltung bietet die Möglichkeit, das Unternehmen als Rechtsträger zu erhalten und die Verantwortung in den Händen der Unternehmensführung zu lassen.
Schutzschirmverfahren (§ 270d InsO):
Dieses Verfahren bietet ein Zeitfenster von bis zu drei Monaten, in dem das Unternehmen unter Schutz vor Vollstreckungsmaßnahmen der Gläubiger steht, um einen Insolvenzplan zu entwickeln. Es setzt voraus, dass das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist und eine positive Sanierungsprognose vorliegt. Das Schutzschirmverfahren ist besonders nützlich, um eine Sanierung in Eigenverwaltung vorzubereiten; erzeugt aber auch erheblichen Zeitdruck.
Insolvenzplan:
Dies ist ein zentrales Instrument der Sanierung im Insolvenzverfahren. Der Insolvenzplan (§§ 217 ff. InsO) stellt ein Sanierungskonzept dar, das von den Gläubigern abgesegnet werden muss. Er soll die Fortführung des Unternehmens ermöglichen und die Gläubiger nach einer bestimmten Quote befriedigen. Der Plan kann Maßnahmen wie Schuldenschnitt, Tilgungspläne oder die Übertragung von Vermögenswerten enthalten.
Übertragende Sanierung:
Hierbei wird der Geschäftsbetrieb auf einen neuen Rechtsträger übertragen, während die alten Schulden im Insolvenzverfahren verbleiben. Dies kann durch Veräußerung des Betriebsvermögens geschehen, wobei der neue Rechtsträger die Geschäfte ohne Altlasten weiterführt. Diese Methode wird oft gewählt, wenn die Eigenverwaltung nicht mehr möglich ist, wenn ein Investor das Unternehmen übernehmen möchte oder wenn der Aufwand für einen Insolvenzplan außer Verhältnis zum verfolgten Ziel steht.
Juristische Begleitthemen
Bedeutende juristische Aspekte bei Sanierung und Restrukturierung:
Haftungsfragen:
Geschäftsführer und Vorstände müssen sich mit der Haftung im Insolvenzfall auseinandersetzen, insbesondere wenn sie nicht rechtzeitig Insolvenz beantragen und Überwachungspflichten missachten (§ 1 StaRUG).
Sanierungsberatung und -planung:
Unternehmen benötigen oft rechtliche und wirtschaftliche Beratung, um die beste Sanierungsstrategie zu wählen. Hierbei sind etwa Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte gefragt, die sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die wirtschaftlichen Chancen und Risiken analysieren.
Gläubigerrechte und -abstimmungen:
Eine erfolgreiche Sanierung setzt die Zustimmung der Gläubiger voraus. Die Insolvenzordnung (InsO) regelt, wie Abstimmungen über Insolvenzpläne ablaufen und welche Mehrheiten erforderlich sind. Das StaRUG enthält ähnliche Bestimmungen für die vorinsolvenzliche Sanierung.
Vertragsrechtliche Anpassungen:
Im Rahmen der Sanierung können Verträge angepasst oder gekündigt werden, um das Unternehmen zu entlasten. Besonders im Schutzschirmverfahren kann das Unternehmen von ungünstigen Verträgen befreit werden.
Arbeitsrechtliche Aspekte:
Restrukturierungsmaßnahmen betreffen oft die Belegschaft. Hier müssen Sozialpläne, Massenentlassungen und Tarifverträge beachtet werden, um rechtliche Konflikte zu vermeiden.
Fazit
Sanierung und Restrukturierung sind sowohl vor als auch im Insolvenzverfahren komplexe, aber notwendige Maßnahmen, um Unternehmen aus einer Krise zu führen. Die Wahl des richtigen Instruments hängt stark von der spezifischen Situation des Unternehmens ab. Juristische Begleitung ( Individuelle Beratung – Hauptseite) ist hierbei essentiell, um die rechtlichen Hürden zu überwinden und eine nachhaltige Lösung zu finden. Die Eigenverwaltung, das Schutzschirmverfahren, der Insolvenzplan und die übertragende Sanierung sind zentrale Elemente, die in Kombination oder einzeln zur Sanierung beitragen können. Das StaRUG bietet zudem eine vorinsolvenzliche Alternative, die die Flexibilität der Sanierung erhöht.