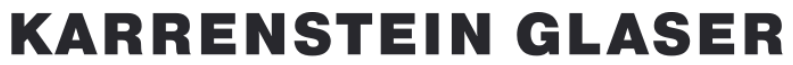Erfahrung, Fachwissen und maßgeschneiderte Strategien – individuell, präzise und zielgerichtet.
Karrenstein Glaser unterstützt Sie dabei, rechtzeitig und effektiv auf finanzielle Herausforderungen zu reagieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Ob die Sanierung, Vergleichsverhandlungen, Eigenverwaltung oder die Liquidation im Regelinsolvenzverfahren – wir finden die beste Lösung für Sie.
Wir wissen, dass finanzielle Herausforderungen das Ergebnis äußerer und politischer Einflüsse oder disruptiver Ereignisse sein können. Daher ist es wichtig die Insolvenzgründe schon vor den ersten Anzeichen einer Krise zu kennen. Nur so können Sie angemessen reagieren.
1. Zahlungsunfähigkeit
Zahlungsunfähigkeit im insolvenzrechtlichen Sinne ist der zentrale Eröffnungsgrund nach § 17 InsO und liegt vor, wenn ein Schuldner nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Sie wird gemäß der Definition als objektiver Zustand der dauerhaften Illiquidität verstanden, wobei kurzfristige Zahlungsstockungen und geringfügige Liquiditätslücken außer Betracht bleiben.
Prüfung der Zahlungsunfähigkeit
Die Zahlungsunfähigkeit wird in einem zweistufigen Verfahren geprüft:
- Bestimmung der Fälligkeit: Relevant sind ausschließlich fällige, rechtlich durchsetzbare Geldverbindlichkeiten. Diese müssen vom Gläubiger ernsthaft eingefordert sein; dies umfasst typischerweise Rechnungen oder Mahnungen.
- Liquiditätsstatus: Es wird geprüft, ob die verfügbaren liquiden Mittel des Schuldners einschließlich solcher, die binnen drei Wochen mit Sicherheit beschafft werden können, ausreichen, um die fälligen Verbindlichkeiten zu decken. Eine Liquiditätslücke von mehr als 10 % der fälligen Verbindlichkeiten über diesen Zeitraum hinweg begründet die Zahlungsunfähigkeit.
Sonderfälle und Abgrenzungen
- Zahlungsstockung: Eine bloß vorübergehende Illiquidität gilt nicht als Zahlungsunfähigkeit. Entscheidend ist, ob die Lücke innerhalb von drei Wochen geschlossen werden kann. In Ausnahmefällen kann den Gläubigern auch ein längeres Warten zugemutet werden. Ist absehbar mit einer vollständigen Beseitigung einer Liquiditätslücke zu rechnen, kann die Definition daher auch normative Elemente enthalten.
- Geringfügige Liquiditätslücken: Eine Unterdeckung von weniger als 10 % gilt nicht als wesentlich, es sei denn, eine Verschärfung ist absehbar.
Gesetzliche Vermutungen und Nachweise
Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO wird Zahlungsunfähigkeit vermutet, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. Eine Zahlungseinstellung, die auf einzelnen nicht unerheblichen Umständen (Rücklastschriften, Vollstreckungsmaßnahmen, nicht eingehaltene Ratenzahlungsvereinbarungen) beruht, kann die gesetzliche Vermutung der Zahlungsunfähigkeit begründen. Diese Vermutung kann unter Umständen durch eine Liquiditätsbilanz widerlegt werden.
Praktische Bedeutung
Die gesetzliche Definition ermöglicht eine objektive und einheitliche Feststellung der Zahlungsunfähigkeit. Sie dient sowohl dem Gläubigerschutz als auch der frühzeitigen Einleitung von Sanierungs- oder Abwicklungsverfahren. In der Praxis treten bei der Prüfung oft Abgrenzungsprobleme zur Zahlungsstockung und drohenden Zahlungsunfähigkeit auf. Für den Nachweis können Liquiditätsbilanzen oder tagesgenaue Finanzpläne verwendet werden.
2. Überschuldung (nur juristische Personen)
Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne liegt vor, wenn das Vermögen eines Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt und zugleich keine positive Fortführungsprognose besteht. Diese gesetzliche Definition ist zentral für haftungsbeschränkte Rechtsträger wie juristische Personen oder Gesellschaften ohne natürliche Vollhafter. Der Tatbestand der Überschuldung dient dem präventiven Gläubigerschutz, da sie in der Regel früher als die Zahlungsunfähigkeit eintritt.
Im ersten Schritt wird die rechnerische Überschuldung ermittelt. Hierzu werden die Aktiva und Passiva des Schuldners gegenübergestellt, wobei die Vermögenswerte zu realistischen Liquidationswerten bewertet werden. Überschuldung liegt rechnerisch vor, wenn die Passiva die Aktiva übersteigen. Die Bewertung folgt dem Grundsatz der Vorsicht und berücksichtigt stille Reserven sowie handelsrechtlich nicht bilanzierungsfähige Vermögenswerte.
Liegt rechnerische Überschuldung vor, ist in einem zweiten Schritt die Fortführungsprognose entscheidend. Diese Prognose prüft, ob die Fortführung des Unternehmens in den kommenden zwölf Monaten überwiegend wahrscheinlich ist. Grundlage bildet ein schlüssiges und realisierbares Unternehmenskonzept, das in der Regel eine detaillierte Finanz- und Ertragsplanung umfasst. Der Fortführungswille des Schuldners sowie die nachhaltige Finanzkraft des Unternehmens sind hierfür ausschlaggebend.
Die Entwicklung des Überschuldungsbegriffs war historisch von rechtspolitischen Veränderungen geprägt. Seit 2008 gilt ein modifiziert zweistufiger Ansatz, der die Fortführungsprognose stärker betont, um solvente, aber durch Krisen belastete Unternehmen vor unnötigen Insolvenzen zu schützen. Aktuell gilt ein einheitlicher Prognosezeitraum von zwölf Monaten. Während der COVID-19-Pandemie wurde dieser Zeitraum vorübergehend auf vier Monate verkürzt.
3. Drohende Zahlungsunfähigkeit (fakultativer Grund)
Von drohender Zahlungsunfähigkeit spricht man, wenn absehbar ist, dass ein Unternehmen zukünftig nicht mehr in der Lage sein wird, fällige Zahlungen zu leisten. Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. In aller Regel ist ein Prognosezeitraum von 24 Monaten zugrunde zu legen.
Hinweise
Suchen Sie frühzeitig unsere Beratung, wenn Sie feststellen, dass die geschäftliche Entwicklung negativ ist oder wenn Sie erkennen, dass äußere Faktoren einen negativen Einfluss auf Ihr Geschäft nehmen können. Wir werden Sie dabei unterstützen die aktuelle Liquiditäts- und Vermögenslage besser einzuschätzen.