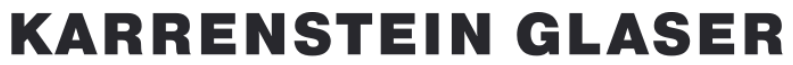Zweck und Nutzen
Feststellung der Insolvenzreife
Ein Gutachten zur Insolvenzreife analysiert die finanzielle Situation eines Unternehmens, um zu ermitteln, ob es zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Zahlungsunfähigkeit liegt gemäß § 17 InsO vor, wenn ein Unternehmen seine fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr erfüllen kann. Überschuldung ist gemäß § 19 InsO gegeben, wenn das Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt und keine positive Fortführungsprognose besteht.
Gegengutachten
Ein Gutachten zur Insolvenzreife kann als privates Gegengutachten beauftragt werden, um die Richtigkeit früherer Gutachten zu prüfen, oder etwa in einem Strafverfahren einer Behauptung der Staatsanwaltschaft entgegenzutreten. Ein solches Gutachten kann die Annahme der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung bestätigen oder widerlegen.
Entscheidungsgrundlage für Insolvenzverwalter:
Insolvenzverwalter nutzen diese Gutachten zur Unterstützung ihrer Entscheidungen. Sie prüfen, ob weitere insolvenzspezifische Ansprüche, wie zum Beispiel Insolvenzanfechtung gegen Gläubiger oder Geschäftsleiterhaftung gegen Geschäftsführer oder Berater, gerechtfertigt sind. So kann der Insolvenzverwalter im Interesse der Masseschonung von der weiteren kostenintensiven Anspruchsverfolgung oder -ermittlung Abstand nehmen oder beurteilen, ob weitere Masseverbindlichkeiten mit der Aussicht der Massemehrung begründet werden können.
Inhaltliche Schwerpunkte eines Gutachtens
- Forensische Analyse typischer Beweisanzeichen der Zahlungsunfähigkeit (Zahlungseinstellung; § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO) anhand von der Rechtsprechung entwickelter Indizien.
- Das Gutachten enthält in der Regel eine Liquiditätsbilanz, die die am Stichtag verfügbaren liquiden Mittel und die kurzfristig hinzukommende Liquidität ins Verhältnis zu fälligen und ernsthaft eingeforderten Verbindlichkeiten stellt. Mittels eigens entwickelter Softwarelösungen, können auch dynamische Betrachtungen für jeden Stichtag angestellt werden, um etwa zu prüfen, ob eine einmal eingetretene Zahlungsunfähigkeit (§ 17 Abs. 2 InsO) fortdauert oder ggf. beseitigt wurde.
- Vermögensneubewertung: Zum Zwecke der Prüfung einer rechnerischen Überschuldung ist eine detaillierte Prüfung sämtliche Bilanzposten erforderlich, wobei Liquidationswerte anzusetzen sind. So lässt sich eine reale Vermögenssituation bestimmen. Dazu gehört auch die Bewertung umstrittener Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Fortführungsprognose: Eine wesentliche Komponente ist die Analyse der Fortbestandsfähigkeit des Unternehmens. Diese Prognose hilft zu entscheiden, ob eine Unternehmenssanierung möglich ist und enthält einen Finanzplan. Besonderheiten ergeben sich hier, da die Fortführungsprognose nicht nur ein theoretisches Konstrukt ist, sondern physisch vorhanden sein muss. Das Fehlen einer verschriftlichten Fortführungsprognose kann daher bei rechnerischer Überschuldung die rechtliche Überschuldung (§ 19 Abs. 2 InsO) begründen.
Fazit
Ein Gutachten zur Insolvenzreife ist kein Werkzeug, sondern Entscheidungshilfe. Es kann dazu beitragen einen komplexen Sachverhalt aufzuklären. Es ist objektiv und überprüfbar. Es kann zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung oder deren Widerlegung führen und bietet so unter Umständen eine Verteidigungsmöglichkeit gegen anderslautende falsche Feststellungen. Die genaue und sachverständige Analyse der finanziellen Lage durch solche Gutachten ist wesentlich für gerichtliche Entscheidungen. Aber auch die Arbeit der Insolvenzverwaltung kann durch ein Gutachten unterstützt werden, um fundierte Entscheidungen zu treffen und potenzielle Ansprüche zu verfolgen oder von der Verfolgung Abstand zu nehmen.